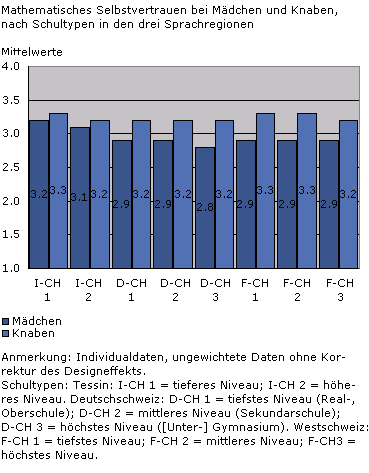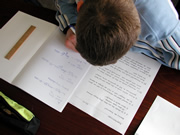Selbstkonzept
Welche Einstellungen zu Schule und Mathematikunterricht bringen die Schüler und Schülerinnen der 8. Klasse in der Schweiz mit sich? Die Schüler und Schülerinnen wurden unter anderem dazu befragt, wie sie ihr mathematisches Selbstvertrauen einschätzen.
Den Lernenden wurden etliche Aussagen zum Bereich "Kontrollüberzeugungen" vorgelegt (Beispiel-Item: "Wenn ich will, kann ich in Mathematik gut sein"). Es war ein vierstufiges Antwortformat vorgegeben ("stimmt genau" = 4, ..., "stimmt gar nicht" = 1). Ein tiefer Mittelwert ist demnach Ausdruck eines eher tiefen Selbstvertrauens, ein hoher Mittelwert hingegen lässt auf ein hohes Selbstvertrauen schliessen. Abbildung 1 zeigt die durchschnittlichen Schülerantworten pro Schultyp und Geschlecht.
Mädchen mit tieferem mathematischem Selbstvertrauen
Die Mittelwerte bewegen sich in allen Schultypen deutlich über dem Mittelpunkt der Skala (über 2.5). Es zeigen sich deutliche Unterschiede in den Selbstberichten von Knaben und Mädchen: Die Mädchen schätzen ihr Selbstvertrauen im Mittel tiefer ein als die Knaben.
Allerdings ist die Geschlechterdifferenz nicht in allen Schultypen und Sprachregionen gleich stark ausgeprägt. Im Tessin unterscheiden sich die Knaben und Mädchen nur wenig voneinander. In sämtlichen Deutschschweizer und Westschweizer Schultypen fällt die Differenz zwischen Knaben und Mädchen deutlicher aus.
Beschränkte Aussagekraft der Mittelwertunterschiede
Es muss an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Darstellung von Mittelwerten auch ihre Tücken hat. Wir erhalten hier lediglich Auskunft über einen Durchschnittswert; Angaben zur Variationsbreite der Werteverteilungen in den einzelnen Schultypen fehlen gänzlich. So gibt es in unserem Datensatz beispielsweise einzelne Klassen, in denen der Unterschied der Mittelwerte sehr gross ist (z.B. Mittelwert der Mädchen = 2.5, Mittelwert der Knaben = 3.4) und umgekehrt Klassen mit sehr geringen Differenzen (z.B. Mittelwert der Mädchen = 3.0, Mittelwert der Knaben = 3.1). Weiter finden sich auch Klassen, in denen die Differenz zwischen Mädchen und Knaben gerade umgekehrt ausfällt (z.B. Mittelwert der Mädchen = 3.2, Mittelwert der Knaben = 2.6).
Gerade jene Klassen, welche von dem oben präsentierten Bild abweichen, sind interessant für weiter gehende Analysen. Es stellt sich hier beispielsweise die Frage, in welchem Masse und auf welche Art und Weise der erlebte Mathematikunterricht Einfluss auf die Entwicklung des Selbstbildes nimmt. In weiterführenden Projektpublikationen sollen solche Fragen genauer ausgeleuchtet werden (vgl. Reusser, Pauli & Waldis, in Vorb.).